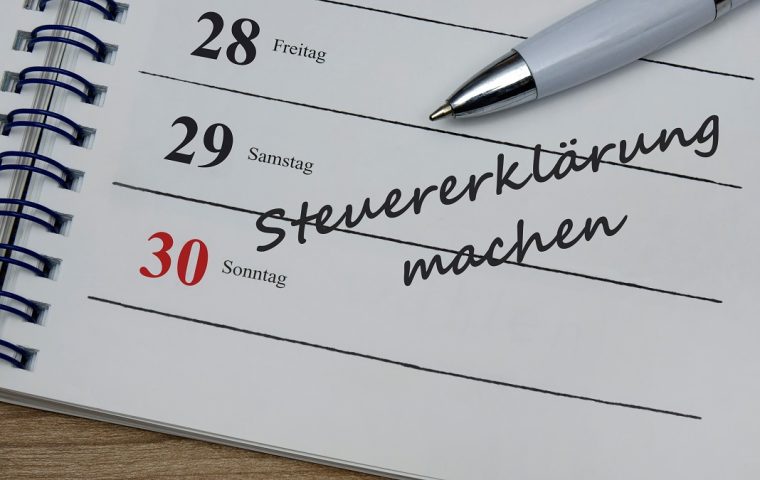Arbeit vs. Bürgergeld: Fakten statt Mythen – Wer hat mehr im Monat?
Wer mehr Geld zur Verfügung hat – Bürgergeldempfänger oder Vollzeitbeschäftigte im Niedriglohnsektor – sorgt regelmäßig für hitzige Debatten. Während in sozialen Medien oft mit falschen Zahlen hantiert wird, zeigt ein realistischer Vergleich: Der Unterschied beträgt mehrere hundert Euro – und nicht nur einen Euro, wie manche behaupten.
Die neue schwarz-rote Koalition nimmt das Bürgergeld ins Visier. Künftig sollen alleinstehende Leistungsbeziehende, die innerhalb eines Jahres zwei Jobangebote ablehnen, mit einer drastischen Konsequenz rechnen: Der komplette Regelsatz von 563 Euro könnte für zwei Monate gestrichen werden. Diese Maßnahme zielt auf sogenannte „Totalverweigerer“ ab – laut Bundesarbeitsagentur betrifft das etwa ein Prozent der rund 1,7 Millionen arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.
Zusätzlich haben sich CDU/CSU und SPD darauf verständigt, die Berechnungsmethode für den Leistungssatz der insgesamt 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger zu überarbeiten. Die Union kritisierte bereits seit langem, dass die Leistungen zu großzügig bemessen seien.
Die Milchmädchenrechnung auf Social Media
Mitte März verbreitete sich auf X (ehemals Twitter) eine Rechnung, die behauptete, eine Person mit Niedriglohn-Vollzeitjob hätte monatlich nur einen Euro mehr zur Verfügung als ein Bürgergeldempfänger. Der Post operierte mit einem Bruttogehalt von 2520 Euro, von dem angeblich 772 Euro für Steuern, 745 Euro für Miete und schockierende 500 Euro für Energiekosten abgehen würden. Bürgergeldempfänger müssten diese Kosten hingegen nicht tragen – so die fehlerhafte Darstellung.
Die Realität in Zahlen: 365 Euro Unterschied
Ein faktenbasierter Vergleich zeigt ein anderes Bild. Nehmen wir zwei fiktive Personen in Frankfurt:
Vera bezieht Bürgergeld. Sie erhält monatlich 563 Euro Regelsatz plus maximal 852 Euro für Miete und Heizung. Wichtig: Stromkosten muss sie selbst bezahlen. Nach Abzug durchschnittlicher Stromkosten (etwa 46 Euro monatlich) bleiben ihr rund 517 Euro für alle weiteren Ausgaben.
Anna arbeitet als Kassiererin in Vollzeit und verdient 2520 Euro brutto, was etwa 1780 Euro netto entspricht. Bei gleichen Wohnkosten wie Vera (852 Euro) verbleiben ihr 928 Euro monatlich für alle weiteren Ausgaben.
Der reale Unterschied beträgt somit nicht einen, sondern 365 Euro. Hinzu kommt: Anna zahlt in die Rentenversicherung ein, Vera nicht.
Warum die Social-Media-Rechnung nicht aufgeht
Die Falschdarstellung basiert auf zwei gravierenden Fehlern: Erstens müssen Bürgergeldempfänger ihre Stromkosten selbst tragen. Zweitens werden die Stromkosten massiv übertrieben dargestellt. Bei einem aktuellen Strompreis von 27 Cent pro kWh (März 2025) zahlt ein Single-Haushalt durchschnittlich 550 Euro im Jahr – nicht 500 Euro monatlich, wie behauptet.
Aufstockung als Brücke für Geringverdiener
Was in der Debatte oft untergeht: Auch Menschen mit niedrigem Einkommen können staatliche Unterstützung erhalten. „Mit der Höhe des Bürgergeldes steht und fällt auch das steuerfreie Existenzminimum aller Beschäftigten“, erklärt Joachim Rock, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, gegenüber „Ippen Media“. Besonders in Metropolen mit hohen Mieten fällt der Unterschied zwischen Geringverdienern und Bürgergeldempfängern geringer aus.
Die Lösung liegt für Rock auf der Hand: „Gegen einen vermeintlich zu geringen Lohnabstand gibt es ein einfaches Mittel: Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns.“ Der von der neuen Koalition geplante Mindestlohn von 15 Euro sei ein „wichtiger Beitrag, um effektiv Armut zu bekämpfen.“
Fakten statt Vorurteile
Die regelmäßig aufflammende Debatte über angebliche „Sozialschmarotzer“ basiert häufig auf verzerrten Darstellungen. Ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt: Arbeit lohnt sich finanziell durchaus gegenüber dem Bürgergeld – wenn auch in manchen Konstellationen weniger stark als gewünscht.
Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Bürgergeld, sondern in der Lohnstruktur am unteren Ende des Arbeitsmarktes. Statt Sozialleistungen zu kürzen, könnte eine Anhebung der Mindestlöhne den Abstand vergrößern und gleichzeitig die Kaufkraft stärken. Der geplante 15-Euro-Mindestlohn wäre ein Schritt in diese Richtung – und würde den Unterschied zwischen Bürgergeld und Arbeitseinkommen deutlicher machen.
Quelle: merkur.de